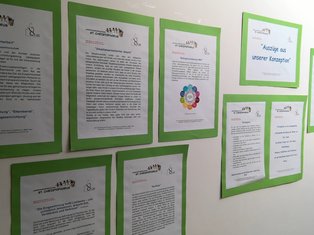Ein konkretes Beispiel für Partizipation im pädagogischen Alltag
Was ziehe ich an?
Im allmorgendlichen Sitzkreis ist oft zum Schluss die Kleidungsfrage ein Thema. Verschiedene anschauliche Materialien, die wir mit den Kindern gestalten (wie z. B. Wettersymbole oder Fotokarten von Kleidungsstücken) bzw. gemeinsame Überlegungen mit dem Blick nach draußen und der Frage, was hängt an meiner Garderobe, können als mögliche Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung beitragen.
Die Bildkarten über das, was die Mehrheit an Kleidung beschließt, werden später an der Gruppentür ausgehangen.
Im Kitaalltag erleben die Kinder, wie viel sie bei einzelnen Prozessen mitbestimmen dürfen und welchen Einfluss sie auf die Gestaltung ihres Alltags nehmen können. Wenn von Partizipation gesprochen wird, spricht man von dem Beteiligungs- und Mitbestimmungsrecht der Kinder. Es bedeutet die Meinung der Kinder zu respektieren und zu berücksichtigen. Ebenfalls gilt es die Kinder in ihrer Individualität zu fördern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Partizipation verlangt von uns Erwachsenen, eigene Entscheidungen einzuschränken, Kompromisse zu schließen und auch ein Stück Macht abzugeben. Es bedeutet aber nicht, „gebt den Kindern das Kommando“. Vielmehr stellt es ein Grundprinzip der pädagogischen Arbeit dar. Die Kinder sollen lernen Verantwortung zu übernehmen und lernen ein demokratisches Verständnis zu entwickeln.
Kinder erfahren dadurch, dass ihre eigene Meinung respektiert und auch berücksichtigt wird. Sie wird in Alltägliche Überlegungen mit einbezogen. So lernen sie selbstständiges Handeln und wie sie selbst zu etwas beitragen können.
Manchmal ist es notwendig Entscheidungen zu treffen, bei denen die Meinung der Kinder nicht berücksichtigt werden kann. Dabei ist es Wichtig den Kindern zu erklären, warum “gegen ihren Willen” entschieden wurde.
Denn genauso wie wir Erwachsenen, haben auch Kinder das Recht auf Rechtfertigung und Meinungsfreiheit. Dazu gehört ebenfalls das Recht zur Beschwerde.
Die Beschwerden der Kinder geben uns immer wieder Hinweise auf deren Wünsche, Meinungen und ihr Wohlbefinden. Daher ist es uns sehr wichtig, dies ernst zu nehmen. Sich über wahrgenommene Missstände beschweren zu dürfen, ist untrennbar mit gelebter Partizipation verbunden. Um den Kindern ihr Recht auf Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten so einfach wie möglich zu machen, müssen die Erwachsen verbale, wie nonverbale Beschwerden zunächst ein Mal wahrnehmen können. Bei Beschwerden von U3 Kindern sind die Fachkräfte besonderes gefordert, auf die Signale der Kinder zu achten. Einige Kinder weinen z.B. oder werden aggressiv, wieder andere werden müde. Solche Anzeichen weisen eventuell darauf hin, dass die jetzige Situation nicht zu den Bedürfnissen der Kinder passt. Ein gutes Umfeld, das die Bedürfnisse aller Kinder ernst nimmt, schafft Raum für Partizipation. Die Kinder wissen, dass sie sich beschweren können, und vertrauen darauf gehört zu werden (Maywald 2019).